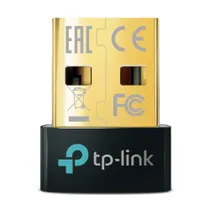Bluetooth Adapter und Sticks
(1 Artikel)Mit Bluetooth Adapter oder Stick rüsten Sie nicht Bluetooth-fähige Geräte ganz einfach nach. Jetzt Bluetooth Adapter günstig online kaufen.
Bluetooth macht den kabellosen Datenaustausch zwischen Mobilgeräten einfach und praktisch. Besonders Notebook und Netbook profitieren von vom populären Kurzstreckenfunk. Fehlt ihnen eine entsprechende Antenne, lässt sich diese problemlos nachrüsten. Worauf Sie bei der Auswahl des richtigen Bluetooth-Moduls achten sollten, zeigt diese Kaufberatung.
Kabelsalat ist nervig. Die Strippen geraten leicht durcheinander, lassen sich schwer trennen und sehen vor allem sehr unschön aus. Weitaus komfortabler und schöner sind Lösungen, die ohne Kabel auskommen und sich über Funksignale miteinander unterhalten können.
Dafür ist Bluetooth zuständig. Die Technik ermöglicht kabellosen Datenaustausch vieler Geräte untereinander und mit einem Computer oder Notebook. Man findet Bluetooth beispielsweise in Notebooks, Netbooks, Mäusen, Tastaturen, Handys, Freisprecheinrichtungen, Digitalkameras, Lautsprechern, digitalen Bilderrahmen und sogar im Autoradio.
Unkompliziert nachrüsten
Eine Vielzahl an Geräten hat Bluetooth bereits integriert. Anderen, von denen man sich den kabellosen Komfort wünscht, fehlt diese Eigenschaft. Glücklicherweise lässt sich die Bluetooth-Fähigkeit häufig einfach und unkompliziert nachrüsten.
Am einfachsten ist das Nachrüsten eines Desktop-PCs, Notebooks oder Netbooks. Speziell für die dort üblichen USB-Anschlüsse gibt es zahlreiche Empfänger, auch Dongle genannt. Aber auch für andere Geräte ist der Kurzstreckenfunk zuweilen nachrüstbar.
Herstellerunabhängig
Nachrüsten ist bei kleinen, tragbaren Geräten wie MP3-Player, Digitalkamera und Ähnlichen oft nur mit speziellem Zubehör vom Hersteller möglich, während Erweiterungen für stationäre Geräte, wie etwa Drucker oder HiFi-Anlagen, auch von Drittherstellern erhältlich sind.
Durch die Vorgaben für die Lizenzierung von Bluetooth ist die Technik herstellerunabhängig. Sender und Empfänger können folglich aus unterschiedlichem Haus kommen. Dennoch gibt es aber noch einige Stolpersteine, die man bei der Auswahl des Nachrüstsatzes bedenken sollte. Worauf Sie im einzelnen achten sollten, erfahren Sie in dieser Kaufberatung.
Seit der Einführung von Bluetooth Mitte der 90er-Jahre hat man die Technik kontinuierlich weiterentwickelt. Zu Beginn war es mit der Version 1.0, genau wie mit allen folgenden 1er-Versionen nur möglich, Daten mit einer theoretischen Maximalgeschwindigkeit von 730 Kilobit pro Sekunde (Kbit/s) zu übertragen. In der Praxis bleibt davon jedoch nicht einmal die Hälfte über.
Mehr Daten lassen sich erst ab der Version 2.0 durch die Luft schicken. Hinter dieser steht in der Regel noch das Kürzel EDR. Es steht für Enhanced Data Rate und bedeutet, dass dieser Standard Daten mit bis zu 2,1 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) übertragen kann. Das entspricht etwa 200 Kilobyte und reicht für kleine Datenmengen, etwa um einige Bilder an den Drucker oder einen digitalen Bilderrahmen zu senden. Aber auch dieser Wert gilt nur in der Theorie. In der Praxis wird auch dieser nicht annähernd erreicht. Bei der Version 2.1 der beträgt der theoretische Maximaldurchsatz drei Mbit/s. In der Praxis liegt der Wert jedoch in der Regel unter einem Mbit/s.
So schnell wie DSL
Die aktuelle Version 3.0 + HS (High Speed) kann Daten deutlich schneller übertragen. Hier beträgt der Maximaldurchsatz 24 Mbit/s. Ursprünglich war diese Version die Nutzung von WLAN-Kanälen und der Ultrabreitband-Technik UWB (engl. Ultra Wide Band) und damit eine maximale Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s geplant. Für beide Lösungen gibt es aber keine verfügbaren Geräte. Die Unterstützung von UWB wird in künftigen Bluetooth-Versionen nicht fortgesetzt werden.
Neuere Versionen sind abwärtskompatibel, können also auch mit älteren Geräten kommunizieren. Kaufberatungstipp: Sie können auch Geräte mit älteren Versionen guten Gewissens weiterverwenden. Nutzbar ist aber jedoch nur das Tempo, welches das Gerät mit dem älteren Standard beherrscht.
Die mögliche Reichweite ist nicht bei allen Geräten, die Bluetooth unterstützen, gleich. Wie weit der Funk reicht, ist abhängig von unterschiedlichen Bluetooth-Klassen, von denen es drei Stück gibt.
Zwei-Klassen-Gesellschaft
Die Klasse 1 beschreibt Geräte, die mit 100 Milliwatt Sendeleistung arbeiten. Damit können sie theoretisch bis zu 100 Meter weit funken. Entsprechende Sender und Empfänger sind oft in Computer und Notebooks eingebaut und häufig auch in Bluetooth-USB-Sticks zu finden.
Klasse-2-Geräte können nur mit bis zu zehn Milliwatt Sendeleistung funken. Das langt aber immer noch für eine theoretische Maximaldistanz von bis zu 50 Metern. Auch hier findet man entsprechende Hardware in PCs, Notebooks und USB-Bluetooth-Erweiterungen.
Zehn Meter für Kleingeräte
Die geringste Reichweite besitzen Geräte, die die Klasse 3 unterstützen. Dort beträgt die Sendeleistung maximal ein Milliwatt. Weiter als zehn Meter dürfen Sender und Empfänger nicht voneinander entfernt sein. Klasse-3-Unterstützung ist typisch für portable Geräte wie Handy, MP3-Player, Digitalkamera etc. Entsprechende Sender und Empfänger findet man seltener zum Nachrüsten.
Sendefrequenz
Als Sendefrequenz verwenden alle drei Klassen das 2,4-Gigahertz-Band. Dieses teilen sich Bluetooth-Geräte mit anderen kabellosen Techniken wie DECT und WLAN. Auch Mikrowellen benutzen diese Frequenz. Probleme sind deswegen aber kaum zu erwarten. Grund: Bluetooth wechselt über eintausend Mal in der Sekunde zwischen den knapp 80 Kanälen des benutzen Frequenzbandes. Diese Unempfindlichkeit trifft auf alle Geräte zu, die mindestens den Standard 1.2 nutzen.
Idealbedingungen
Generell sind die genannten Reichweiten nur unter optimalen Bedingungen zu erreichen, etwa bei freier Sicht ohne ein Hindernis zwischen Sender und Empfänger. In der Realität sind aber oft Wände, Taschen oder anderes im Signalweg, so dass die maximale Reichweite abnimmt. Besonders Betonwände und große Metallgegenstände können das Funksignal intensiv stören und reduzieren die zu überbrückende Strecke nicht selten auf nur wenige Meter.
Die unterschiedlichen Klassen sind für Bluetooth-Geräte keine Verständigungshürde. Treffen zwei Geräte unterschiedlicher Klassen aufeinander, ist prinzipiell auch eine Kommunikation möglich. Ob es letztendlich mit der Verständigung klappt, ist vielmehr von so genannten Profilen abhängig.
Profile legen fest, welche Art von Datenströmen möglich sind. Um beispielsweise ein Foto senden und empfangen zu können, müssen beide Geräte das entsprechende Profil beherrschen, in gewisser Weise also dieselbe Sprache sprechen. Für das genannte Beispiel ist etwa die Unterstützung des Basic Imaging Profile (BIP) Voraussetzung. Ist ein Drucker involviert, kommt auch das Basic Printing Profile (BPP) hinzu.
Wichtige Profile
Die Profile verbergen sich in der Regel hinter schwer verständlichen Abkürzungen, die man jedoch nicht alle kennen muss. Es ist aber vorteilhaft einige Profile zu kennen. Dazu zählt etwa A2DP. Das steht für Advanced Audio Distribution Profile und ist immer dann wichtig, wenn man Musik in stereo per Bluetooth übertragen möchte. Unterstützt eine Hardware das Protokoll nicht, hört man nur mono.
Möchte man mittels Bluetooth Fernsteuerbefehle übertragen, ist das AVRCP-Profil (Audio Video Remote Control Profile) wichtig. Die Übertragung von Audio- und Videodaten regelt das GAVDP (Generic AV Distribution Profile). Es existieren noch zahlreiche weitere Profile, die man aber nicht unbedingt kennen muss. Daher gehen wir hier nicht näher darauf ein.
Kosten sparen
Praktisch zum Kosten sparen ist eine so genannte Fernvorabfragefunktion. Ist sie aktiviert und es liegt eine Nachricht vor, nimmt der Anrufbeantworter beispielsweise schon nach zwei Klingeltönen ein neues Gespräch an, unabhängig von der gewählten Klingelzahl. Liegen keine Anrufe vor, wartet das Gerät länger, bis es den Anruf übernimmt. Ruft man nun von außerhalb an und das Gerät klingelt länger als zweimal, liegt keine Mitteilung vor und man kann guten Gewissens auflegen, bevor eine Verbindung besteht und die Gebühren laufen. Sehr praktisch!
Profile kontrollieren
Wichtig ist immer nur zu kontrollieren, dass die Geräte, die man per Bluetooth nutzen möchte, sich unterhalten können, also die jeweils nötigen Profile für die entsprechende Anwendung beherrschen. Einen kompletten Überblick über alle Profile sowie weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der Bluetooth Special Interest Group (SIG) (engl.).
Kaufberatungstipp: Möchten Sie auf einem Computer mit Windows-Betriebssystem Bluetooth nachrüsten, sollte darauf mindestens Windows XP inklusive Service Pack 2 installiert sein.
Um Bluetooth nutzen zu können, ist in der Regel keine Installation notwendig. Eine Ausnahme kann ein Computer mit älterem Betriebssystem sein, wenn dessen Bluetooth-Funktionen weniger Ausstattung und Komfort bieten, als die Treiber der zu installierenden Hardware. Andere Geräte mit Bluetooth-Fähigkeit sind umgehend einsatzbereit.
Treffen zwei Geräte aufeinander, die Bluetooth unterstützen und aktiviert haben, findet das sogenannte Pairing statt. Das heißt, die Geräte klären untereinander ab, ob sie miteinander kommunizieren können und stellen sich automatisch entsprechend ein. Das Pairing findet nur beim ersten Kontakt statt. Treffen beide Geräte erneut aufeinander, können sie umgehend Daten austauschen.
Kommunikation erlauben
Vor dem ersten Datenaustausch muss aber der Anwender den Datenaustausch normalerweise explizit gestatten. Bei älteren Bluetooth-Versionen ist es dazu mitunter nötig, in den Einstellungen am sendenden Gerät den Empfänger zu suchen. Das alleine ist oft auch nicht ausreichend. Häufig ist es auch nötig, eine automatisch vom Sender vergebene und angezeigte PIN-Nummer beim Empfänger einzutragen. Diese regelt, dass beide den gleichen Schlüssel für die Datenverschlüsselung verwenden. Dieser Weg soll unerlaubten und heimlichen Zugriff auf Daten unterbinden.
Stromverbrauch
Nicht vergessen sollte man, dass die Benutzung von Bluetooth zusätzlichen Strom benötigt. Wer Kabel links liegen lässt und Daten stattdessen per Bluetooth durch die Luft schickt, braucht Energie. Per Kabelverbindung kommt diese nicht selten durch die Leitungen, etwa bei Maus und Tastatur. Ohne Kabel müssen die Geräte mit Akkus oder Batterie arbeiten.
Bluetooth-Netze
Bis zu acht Bluetooth-Geräte können sich in einem Mininetzwerk, dem so genannten Piconetz, gleichzeitig miteinander unterhalten. Allerdings bewältigen viele Geräte synchronen Datenaustausch nur mit bis zu maximal drei Teilnehmern. Wem das nicht genug ist: Insgesamt unterstützt Bluetooth bis zu zehn solcher Piconetze am selben Ort, wobei jedes Gerät in unterschiedlichen Netzen aktiv sein kann. Spezielles Einrichten ist für diese Netze nicht nötig. Sie entstehen automatisch, wenn man die unterschiedlichen Geräte miteinander verbindet (Pairing).
Vorsicht! Ein aktives Bluetooth-Modul kann zum Sicherheitsproblem werden und im Extremfall Unbefugten Zugriff auf PC, Handy und Co. ermöglichen. Diesen können im Unglücksfall unbemerkt Daten auslesen oder kopieren. Dem sollten Sie stets einen Riegel vorschieben und sämtliche Eingangstore versperren.
Geräte verstecken
Kaufberatungstipp: Machen Sie Ihre Geräte unsichtbar. Dann können fremde Bluetooth-Empfänger diese nicht sehen. Praktisch: Gepaarte Geräte erkennen sich dennoch. Die entsprechende Einstellung nehmen Sie im Menü der Geräte vor. Schalten Sie Bluetooth zudem immer nur dann ein, wenn Sie es benötigen und deaktivieren Sie es anschließend wieder. Das hat bei tragbaren Geräten darüber hinaus den Vorteil, dass der Akku geschont wird und länger durchhält.
Unterbinden Sie zudem den automatischen Verbindungsaufbau mit Geräten in Empfangsreichweite. Aktivieren Sie stattdessen die Funktion, jede Verbindung durch Tastendruck bestätigen zu müssen. Das mag zwar störend wirken, schützt aber vor heimlichen Zugriffen.
Keine Standard-PINs verwenden
Sinnvoll ist zudem, von den Geräten vorgegebene Standard-Passworte zu ändern. Häufig schlagen diese beim Pairing Standard-PINs vor, die damit für Fremde leicht zu erraten sind. Somit ist es besser, diese Zeichen selbst zu vergeben. Verwenden Sie dabei möglichst acht oder mehr Zeichen. Dann sind die Kennungen praktisch nicht zu knacken, was bei kurzen Nummern durchaus der Fall sein kann.
Manchmal ist es allerdings nicht möglich, eigene Zeichenfolgen einzugeben, nämlich in der Regel dann, wenn an einem Gerät keine Dateneingabe vorgesehen ist, wie beispielsweise bei einer Freisprecheinrichtung. In solchen Fällen liefern die Hersteller einen PIN-Code mit, den man am kommunizierenden Gerät eintragen muss. Da auch hier meistens ein Standardcode verwendet wird, sollte Sie bei Geräten, die wichtige Daten austauschen, besonderes Augenmerk auf die übrigen möglichen Sicherheitsvorkehrungen legen.
Unterstützen beide Geräte mindestens die Bluetooth-Version 2.1 EDR, ist keine PIN-Eingabe mehr nötig, Sender und Empfänger einigen sich selbstständig.